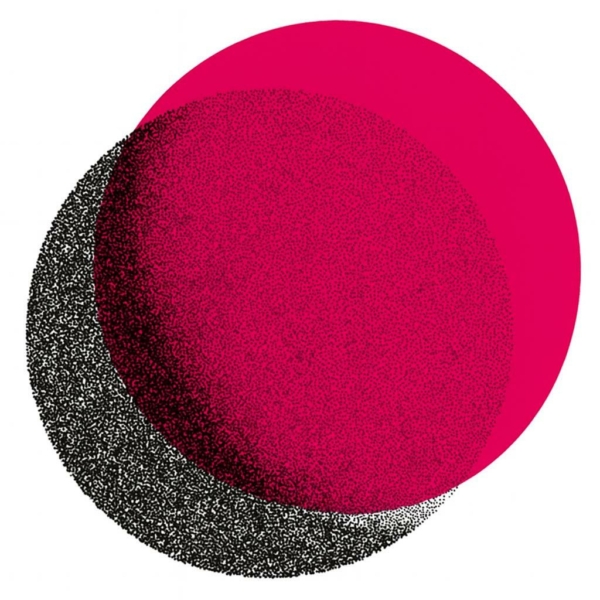Ziel des Forschungsprojekts ist die Analyse und erstmalige Scharfstellung dessen, was um 1970 in der Kunstkritik passiert: Hier beginnt eine bis heute andauernde Rhetorik der „Krise“ der Kritik, während zugleich im Zuge feministischer Bewegungen die neue Sozial- und Diskursfigur der Kritikerin in diesem bis dato androzentrisch geprägten Bereich in Erscheinung tritt. Dieser spannungsreichen, bislang ignorierten Koinzidenz geht das Forschungsprojekt am Beispiel der für diesen Umbruch repräsentativ erachteten Kritikerinnen nach. Zeitgleich haben Annette Michelson, Gertrud Koch und Helke Sander sowie Catherine Millet in den USA, der BRD und Frankreich über eigene Zeitschriften neue ethisch-ästhetische Agenden vorgelegt, sich über ein neues theoretisches Referenzsystem vernetzt und Pionierarbeit in der sprachlichen und methodischen Erschließung zum Teil neuer künstlerischer Ausdrucksfelder geleistet. In den sich dergestalt verändernden Kritikpraktiken werden Möglichkeiten einer distanzierenden und freien Aneignung von gesellschaftlich-disziplinierenden, androzentrisch geprägten Regelwerken erprobt, in die die Kritikerinnen hineingewachsen waren. Das Projekt fragt, wie sie aus ‚anders‘ sozialisierten Perspektiven Wertfragen und Weltverhältnisse an Kunst neu verhandeln. Leitende These ist, dass sich dabei produktive, bislang (mit epistemischer Gewalt ignorierte) Kritikformen detektieren lassen, die die Rede von einer Krise in Frage stellen. Stattdessen lässt sich von einem Neuverortungsmoment der Kritik sprechen, den das Projekt in Rückkoppelung zu vorangegangenen, ‚modernen‘ Kritikformen profilieren wird. Untersucht wird der Zusammenhang von künstlerischen Ausdrucksformen, medialen, epistemologischen und ökonomischen Transformationen und kunstkritischen Praktiken um 1970. Dabei wird auch das Potential ausgelotet, das das Sprechen über Kunst als Beitrag für eine gelingende Debattenkultur (nach wie vor) birgt. Das Projekt legt einen grundlegenden Beitrag zur (noch ungeschriebenen) Geschichte der Kunstkritik vor.
Projektleitung: Prof. Dr. Stephanie Marchal
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen: Sophia Holzmann M.A., Anna Schrepper M.A.
Wissenschaftliche Hilfskräfte: Clara Maria Heggemann, Michelle Jasmin Kubitza, Mina Schilling
Förderung seit 2025